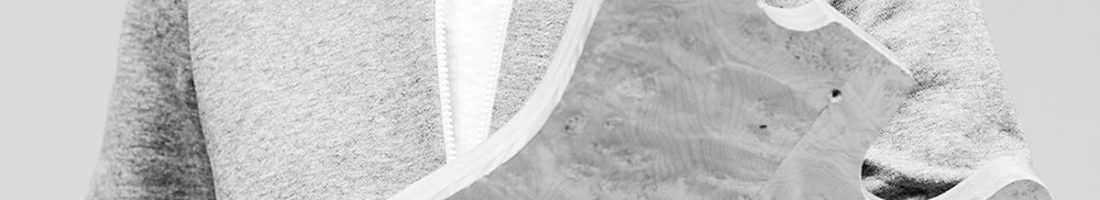Der Instrumentenbauer Alexander Markusch.
Von
Als Instrumentenbauer muss man von drei Dingen etwas verstehen: von Musik, vom Handwerk und vom Kaufmännischen. „Da ist was dran“, stimmt mir Alexander Markusch zu, schränkt dann aber lachend ein: „Beim Kaufmännischen bin ich bei mir nicht so sicher.“ Wie das gemeint ist, erfahre ich im Verlauf unseres Gesprächs. Ich besuche Alexander in seiner Werkstatt in der Bänschstraße 50. Mir öffnet ein großer, schlanker, sehr lebendiger Mann, „bestes Alter“, wie man so sagt, jemand, der einem beim Sprechen in die Augen sieht und schnell, aber überlegt antwortet. In der Nähe des Alexanderplatzes aufgewachsen, hat er einen sehr wichtigen Teil seines Lebens außerhalb Berlins zugebracht.
Musik als Beruf
„Ich wolle etwas mit Musik machen, aber kein reiner Musiker werden oder nur als Lehrer arbeiten“, erklärt er, als ich nach seinem Berufsweg frage. „Zuerst dachte ich an den Beruf des Tonmeisters. Aber da gab es nur alle drei oder vier Jahre einen Ausbildungsplatz, an den man nur mit Vitamin B, mit Beziehungen heran kam. So bin ich an die Weimarer Musikhochschule ‘Franz Liszt’ gekommen und habe Musikerziehung studiert. Dazu gehörte auch eine klassische Klavier- und Gitarrenausbildung. Ich spielte in Studentenbands. Schon damals hieß es: ‘Alex, kannste mal hier was schrauben?’“ Der Weg der weiteren Berufsentwicklung verlief ungewöhnlich. „Immer wieder bin ich von Weimar ausgebüchst ins Voigtland nach Klingenthal, Markneukirchen und Adorf, wo die Familienbetriebe der Instrumentenbauer seit vielen Generationen leben. Da habe ich mich in die Musima, einen Instrumentenbetrieb in der DDR, eingeschlichen, indem ich den Pförtner mit Kaffee und Schnaps bestochen habe.“ Zunächst ging es nur um die Beschaffung von Ersatzteilen, die es in den Geschäften nicht zu kaufen gab, bald auch um Tipps und Tricks für Reparaturen. Es war nicht einfach, in diese landschaftlich abgeschieden lebenden und beruflich geschlossene Familienkreise einzudringen. „Im guten Sinne, wenn es um gegenseitige Unterstützung und Rat ging, aber auch im schlechten Sinne war das eine Vetternwirtschaft.“ Als Berliner war er zunächst vollkommen draußen. Trotzdem gelang es ihm, das Vertrauen zu einem Gitarrenbauer zu gewinnen, ja sogar eine Ausbildung anzufangen. „Das war gar nicht erlaubt. Er durfte das nicht und ich war noch Student in Weimar.“ Entsprechend entwickelten sich die theoretischen Studienergebnisse bei Alexander.

„Illegale“ Ausbildung
„Der Bruch kam, als die Volksbildung von uns eine Unterschrift dafür verlangte, dass sie uns für Jahre in irgendeine Schule wo auch immer stecken konnte. Das bedeutete, dass eine gewisse Parteinähe verlangt wurde, man stärker unter Beobachtung stand und nicht reisen durfte. Außerdem war mir die Zeit zu schade.“ Hinzu kamen die schlechten Leistungen. „In dieser Situation kam ich einer Exmatrikulation zuvor.“ Da war es schon 1990. „Ich habe dann rumgejobbt, bin Gründungsmitglied der Kulturbrauerei geworden, hab die Musikschule dort mit aufgebaut und Gitarren repariert.“ Dann arbeitete er bei Gitarren-Checkpoint, einem Instrumentenladen, der damals auch Vintage-Instrumente der beiden klassischen US-Marken für E-Gitarren „Fender“ und „Gibson“ vertrieb. „Wir sind mehrfach pro Jahr in die Staaten zu Vintage- Messen gefahren, wo sich mein Chef mit alten Instrumenten eindeckte, die er dann hier verkaufte. Dafür schätzte er mein Wissen.“ Aber auch Alexander lernte viel dabei. „Vor allem begriff ich, wie Musiker ticken, denken, fühlen.“ Es gibt Instrumentenbauer, die eher technisch an den Instrumenten interessiert sind. Für den Instrumentenbau ist es aber wichtig, Empathie entwickeln, zu erfahren, wie die Musiker spielen und was sie mit dem Instrument machen wollen. „Wo soll die Reise hingehen?“ erläutert der Handwerker. Das geht auch so weit, dass man auf anatomische Besonderheiten des Spielens der Musiker eingeht.“


Vom Glück der Versenkung
Manche Musiker wissen gar nicht, dass ein Instrument eingespielt werden muss. „Eine gute Konzertgitarre ist nach zwei bis drei Jahren intensiven Spielens ausgreift.“ Auch Fabrikgitarren werden durch Spielen besser. Sogar E-Gitarren klingen mit der Zeit schöner. Hier ist es der Holzkörper, der eingeschwungen wird. „Bei guten E-Gitarren merkt man den Unterschied bereits nach einem halben oder dreiviertel Jahr.“ Der Ton entsteht durch die Schwingungen der Saiten und des Korpus. Das ist es, was der Tonabnehmer aufnimmt und verstärkt. „E-Gitarrenbau ist auf eine bestimmte Art vielleicht noch schwieriger als der Bau von Konzertgitarren“, sagt Alexander. „Da müssen Holzsorte, Trocknung und Schnitt stimmen. Manchmal höre ich schon, wohin die Reise geht, wenn ich ein Stück Holz in die Hand nehme.“ Wir kommen auf eine Erfahrung zu sprechen, die vor allem Künstler und Handwerker machen, wenn sie sich so intensiv in ihr Werk hinein vertiefen können, dass sie einen kontemplativen Zustand erreichen und eins mit ihrem Werkstück werden. Es gibt Goldschläger, die können mit den Fingerspitzen die Dicke des Metalls auf Zehntelmillimeter exakt bestimmen, manche Uhrmacher hören am Klang der Unruhspirale, ob die Uhr richtig läuft und einige Maschinenbauer hören mit einem Stethoskop, ob Lager schadhaft sind und die Motoren rund laufen. Kein Witz – im ländlichen Raum gibt es Klempner, die Wasserleitungen mit der Wünschelrute suchen und finden. „Mein Gitarrenbau-Lehrer zeichnete den Korpus einer Gitarre immer frei Hand auf. Er konnte dann durch das Schleifen der Holzdicke an bestimmten Stellen zuverlässig den besten Klang herausholen. ‘Das muss man fühlen’, erklärte er. Es geht nicht um die Einhaltung von Zentimetern.“ Nicht alle kennen diese Erfahrung. „Wenn ich sage, dass Gitarristen beim Spielen des Instrumentes einen Raum vor sich spüren müssen, dann merke ich bei manchen Kunden, dass sie das nur für esoterischen Blödsinn halten.“

Der Kiez trägt
Wer kommt in den Laden? „Ganz verschiedene Leute“, erwidert Alexander. „Das ist die Mutti mit einer 50-Euro-Kindergitarre, das sind aber auch Künstler wie Westernhagen, Schweighöfer oder die Musiker von Rammstein.“ Der Instrumentenbauer ist auch Berater für Gibson für den Bau neuer Gitarrentypen: „Sogenannte Signaturinstrumente, die, wenn sie für gut befunden werden, in die Serienproduktion gehen. Neben Neuauflagen von Vintage- Instrumenten werden heutzutage auch sieben- und achtsaitige Gitarren gebaut, die eine hohe Virtuosität ermöglichen.“ Auf der Suche nach einem Ort für seine Werkstatt hat der Gitarrenbauer zwei finanziell lukrative Angebote ausgeschlagen, weil er sich dort nicht wohl fühlte. „Hier ist es ein bisschen ruhig, man kennt sich, nimmt Päckchen an, nimmt Wege auf sich und merkt, dass der Kiez trägt. Wenn ich mich beim Bäcker über das gerade eingegangene Schreiben des Steueramts beklage und ein paar aufmunternde Wort erhalte, dann fühle ich mich gleich besser.“ Musikalisch kommt es dem Instrumentenbauer gar nicht mehr darauf an, schnell zu sein. „Das Wichtigste bei der Musik sind die Pausen, ist die Ruhe. Jeder Ton muss klingen. Ich nehme auch längst nicht mehr jeden Auftrag an. Es muss Spaß machen.“ Möge der Spaß immer mit dabei sein.